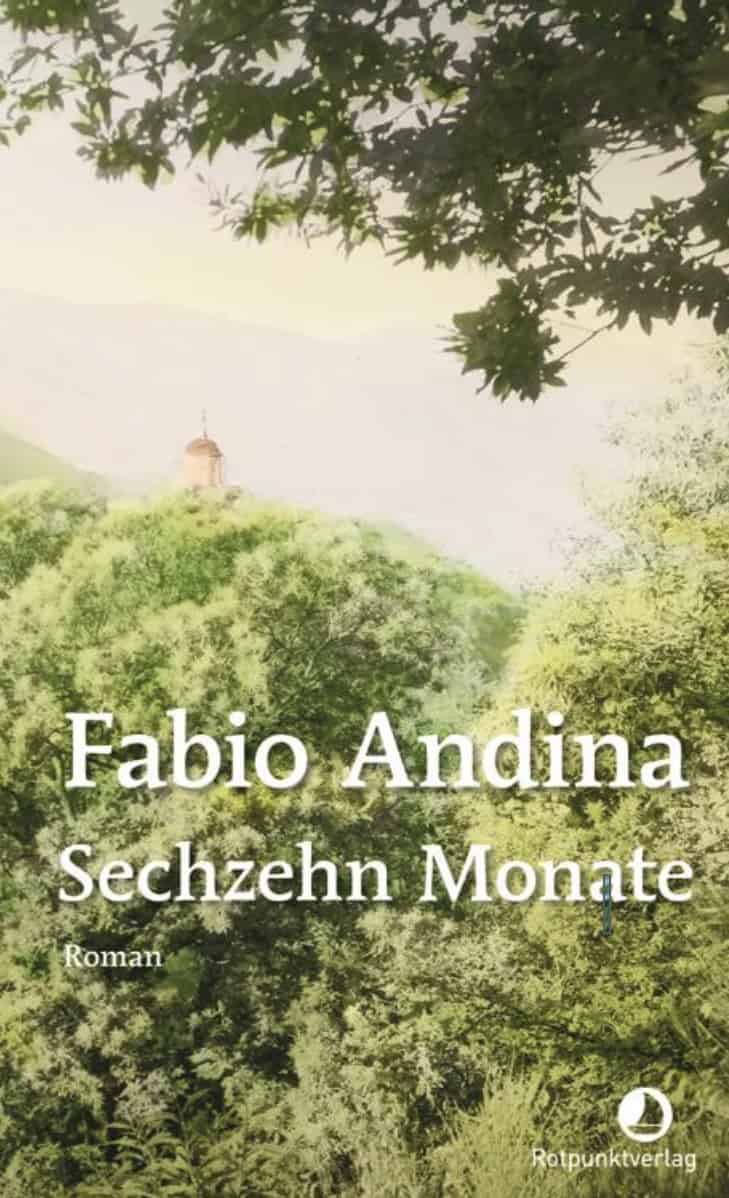Fabio Andinas Roman „Sechzehn Monate“ erzählt die erschütternde Geschichte seines Großvaters Giuseppe Vaglio, der 1944 von der deutschen SS verhaftet wurde, weil er Juden bei der Flucht über die italienisch-schweizerische Grenze half, und nach sechzehn Monaten Gefangenschaft – darunter im KZ Mauthausen – traumatisiert zu seiner Familie zurückkehrte.
Fabio Andina – Struktur und Sprache
Der Roman entfaltet ein komplexes Geflecht aus verschiedenen Zeitebenen und Perspektiven, wobei die Erzählung zwischen Giuseppes Erlebnissen in Gefangenschaft, Concettas Warten und den Geschehnissen im Dorf wechselt. Diese Struktur vermittelt zwar die Vielschichtigkeit der Kriegserfahrung, führt jedoch manchmal zu Unklarheiten im chronologischen Ablauf. Sprachlich besticht Andinas Werk durch eine nüchterne, reduzierte Prosa, die in schmerzlichem Kontrast zur dargestellten Brutalität steht und das Grauen der Konzentrationslager eindrücklich vermittelt, ohne in Sentimentalität zu verfallen.
Die von Karin Diemerling besorgte Übersetzung aus dem Italienischen bewahrt diesen lakonischen Grundton weitgehend, wenngleich einige Passagen die poetische Qualität des Originals nicht vollständig transportieren können. Besonders in den Dialogszenen fehlt mitunter die sprachliche Feinabstimmung, um regionale Nuancen und soziale Unterschiede zwischen den Figuren angemessen darzustellen.
Zwischen Dokumentation und Fiktion
Die Balance zwischen historischer Wahrheit und literarischer Freiheit stellt eine zentrale Herausforderung in Andinas Werk dar. Der Autor füllt die Leerstelle des Schweigens seines Großvaters mit eigener Imagination, wobei die Grenzen zwischen recherchierter Geschichte und künstlerischer Gestaltung fließend bleiben. Die Eröffnungsszene, in der Giuseppe einer jüdischen Familie bei der Flucht über die Tresa hilft, illustriert diese Gratwanderung eindrucksvoll – sie vermittelt authentisch die Gefahren und moralischen Dilemmata der Fluchthilfe im faschistischen Italien.
Als Schwachpunkt erweist sich jedoch die teilweise unscharfe Darstellung der historischen Zusammenhänge. Die komplexen politischen Verhältnisse im Italien der Jahre 1944/45, die Rolle der Partisanen und die moralischen Grauzonen der Kollaboration werden zwar angedeutet, aber nicht mit der nötigen Tiefe ausgeleuchtet. Dies zeigt sich beispielhaft in der Begegnung zwischen Giuseppe und Pietro, die die Konflikte innerhalb der Dorfgemeinschaft nur oberflächlich streift, ohne die ideologischen Hintergründe vollständig zu entfalten.
Charakterentwicklung als Stärke
Die Charakterisierung der Hauptfiguren gehört zu den besonderen Stärken des Romans. Giuseppe wird als gewöhnlicher Mann dargestellt, der durch außergewöhnliche Umstände zum unfreiwilligen Helden wird. Seine innere Entwicklung und sein Kampf um Würde unter unmenschlichen Bedingungen sind eindrucksvoll geschildert, besonders in den Momenten, in denen ihn die Gedanken an seine Frau Concetta am Leben halten: „Dieses Gift hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.“
Concetta verkörpert als stille Heldin des Alltags das Schicksal unzähliger Frauen, die während des Krieges allein zurückblieben. Ihre nie ankommenden Briefe an Giuseppe zählen zu den bewegendsten Passagen. Weniger tiefgründig erscheinen dagegen die Nebenfiguren der Dorfgemeinschaft, die mitunter stereotyp wirken.
„Sechzehn Monate“ erweist sich trotz seiner strukturellen und kontextuellen Schwächen als wichtiger Beitrag zur literarischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Das zentrale Motiv des Schweigens – sowohl das erzwungene Schweigen in der Gefangenschaft als auch das lebenslange Schweigen des Großvaters über seine traumatischen Erlebnisse – durchzieht den Roman als transgenerationales Trauma, das der Autor durch sein Werk zu durchbrechen versucht.
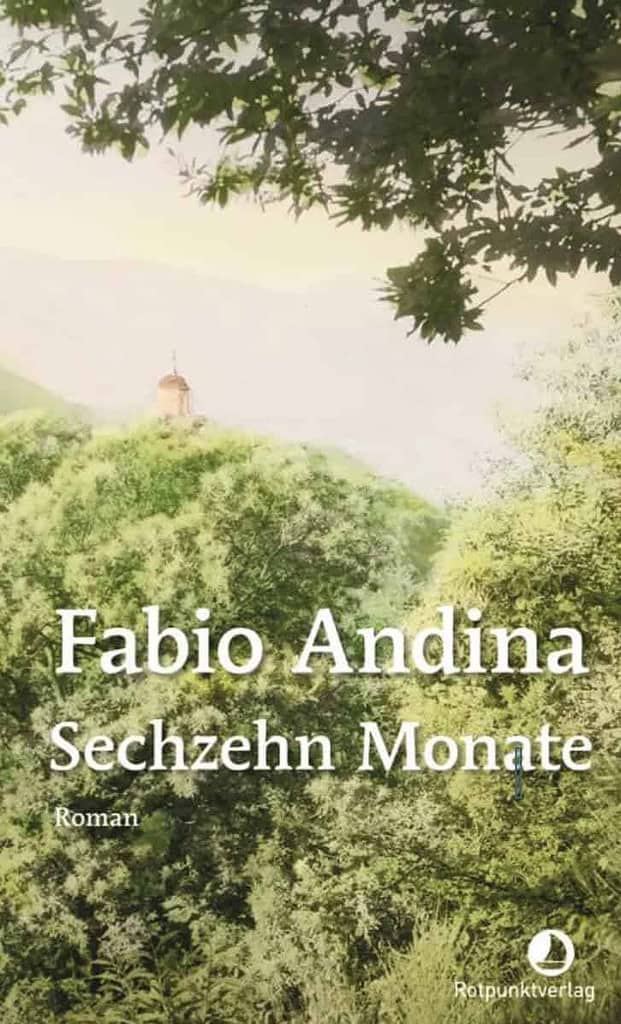
Fabio Andina, 1972 in Lugano geboren, ist ein Schweizer Schriftsteller, der seine Wurzeln tief in der Tessiner Landschaft verankert hat. Nach seinem Studium der Filmwissenschaften und des Drehbuchschreibens in San Francisco kehrte er in seine Heimat zurück und lebt heute im abgeschiedenen Bleniotal, einer Region, die immer wieder zur Inspirationsquelle seiner literarischen Werke wird.
Mit seinem Roman Tage mit Felice, der 2020 erstmals auf Deutsch erschien, gelang Andina ein leises, aber eindringliches Porträt des einfachen Lebens in den Tessiner Alpen. Das Buch erzählt von der stillen Größe des Alltags, von der rauen Schönheit der Berge und der Kraft der Rituale, die das Leben des alten Felice bestimmen.
Andina zeichnet mit feinem Pinselstrich das Bild eines Dorfes, das den Härten der Jahreszeiten trotzt, wo die Menschen wortkarg, aber herzlich sind und wo das Glück in der Kargheit und im Einklang mit der Natur zu finden ist. Für dieses Werk wurde er unter anderem mit dem Terra-Nova-Preis der Schweizerischen Schillerstiftung und dem Premio Gambrinus ausgezeichnet; es wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und von der Kritik als „zauberhaft poetisches Buch“ gefeiert.
2021 folgte der zweisprachige Prosaband Tessiner Horizonte – Momenti Ticinesi, bereichert durch die einfühlsamen Zeichnungen von Lorenzo Custer. Hier verschmelzen Wort und Bild zu einer Hommage an die Tessiner Landschaft und ihre Menschen, die zwischen Tradition und Moderne ihren eigenen Rhythmus bewahren.
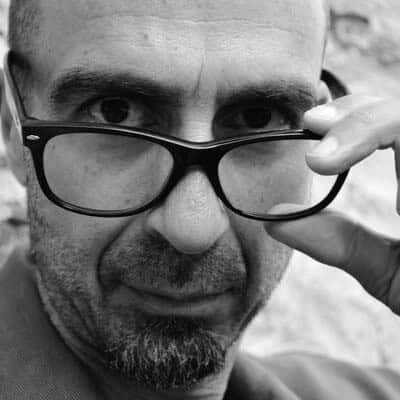
Mit dem Roman Davonkommen (2023) öffnet Andina ein weiteres Kapitel seines erzählerischen Kosmos: Er beleuchtet die Vorgeschichte des namenlosen Erzählers aus Tage mit Felice. In einer bewegenden Erzählung über Verlust, Selbstfindung und die Suche nach innerem Frieden schildert er den Weg eines Mannes, der nach einer persönlichen Krise Zuflucht in einem alten Ferienhaus sucht und dort – zwischen den Schatten der Vergangenheit und der Stille der Berge – langsam zu sich selbst zurückfindet.
Sein literarisches Schaffen umfasst zudem den italienischsprachigen Erzählband Sei tu, Ticino?, der die Vielfalt und Eigenart des Tessins in kurzen, atmosphärischen Texten einfängt.
Fabio Andinas Werke sind geprägt von einer tiefen Verbundenheit mit der Natur, einer Vorliebe für das Unspektakuläre und einer leisen, aber eindringlichen Poesie. Seine Geschichten entfalten ihre Wirkung in der Stille, im Unausgesprochenen – sie sind eine Einladung, innezuhalten und das Wesentliche im Alltäglichen zu entdecken.