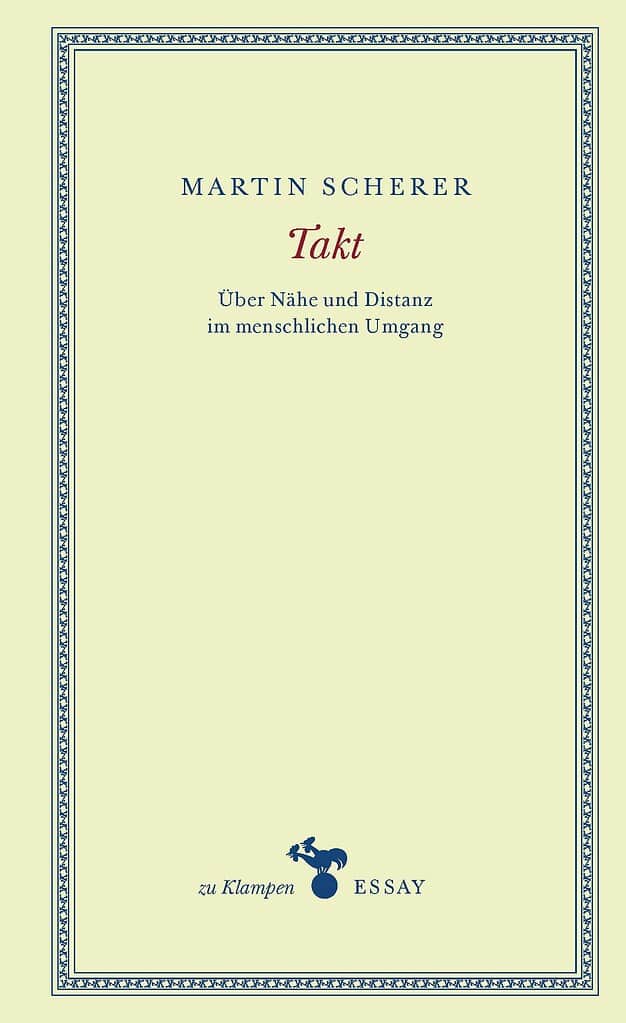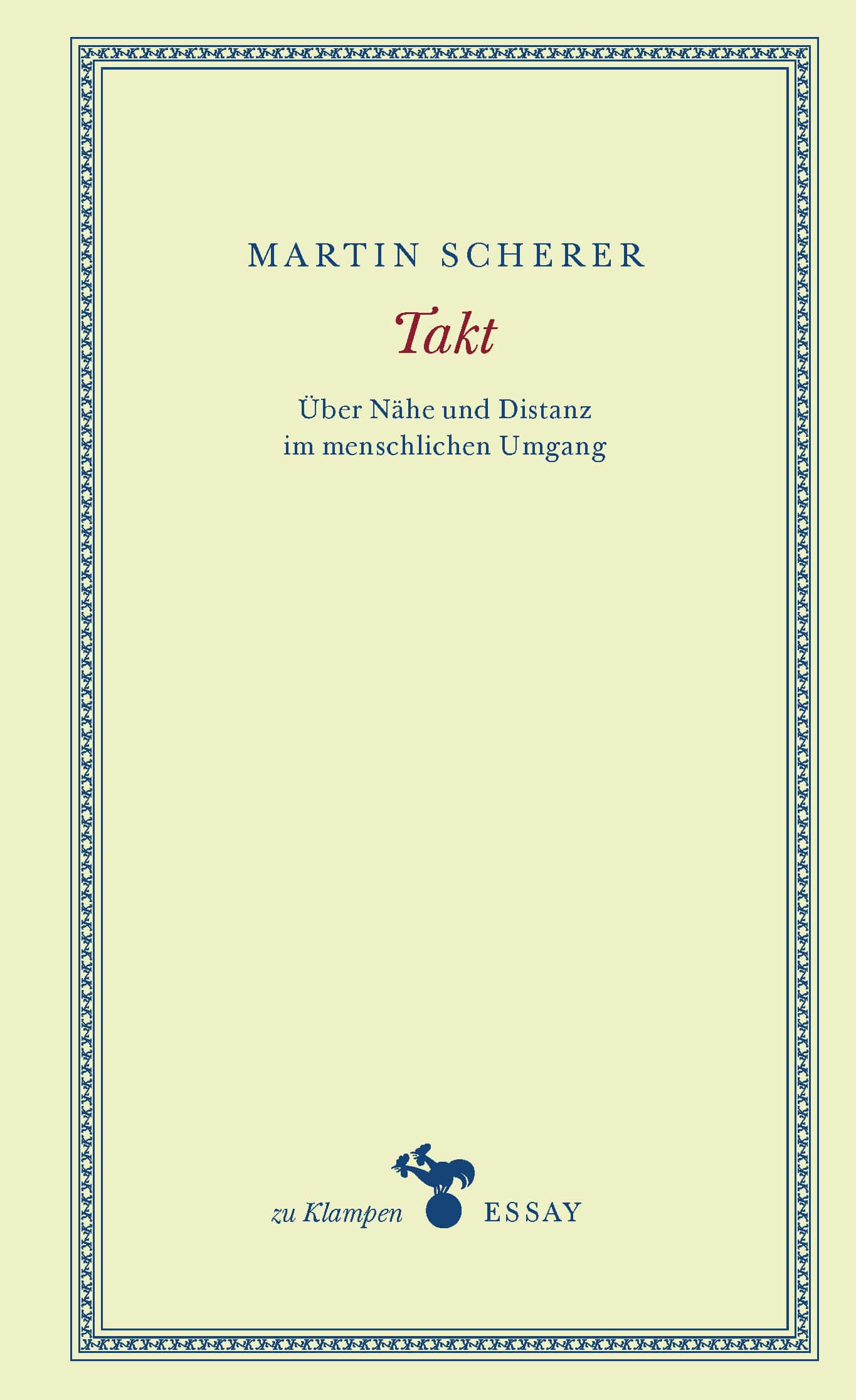In einer Zeit, in der polarisierende Debatten, Hasskommentare und ungefilterte Meinungsäußerungen den öffentlichen Diskurs dominieren, widmet sich der Philosoph Martin Scherer in seinem Essay „Takt“ einem fast vergessenen Konzept des zwischenmenschlichen Umgangs. Das im August 2024 im zu Klampen Verlag erschienene, 120 Seiten umfassende Werk untersucht das Taktgefühl als möglichen Gegenentwurf zu einer zunehmend verrohenden Kommunikationskultur.
Die Wiederbelebung einer verkannten Tugend
Scherers Essay beleuchtet die Bedeutung des Taktgefühls als eine Fähigkeit, die es uns ermöglicht, dem anderen mit Verständnis zu begegnen, ohne seine Motive vollständig nachvollziehen zu müssen. Er argumentiert, dass Takt mehr als nur die Einhaltung von Konventionen ist – es ist eine Form der Improvisation, die es uns erlaubt, uns in sozialen Situationen feinfühlig zu bewegen.
Scherer untersucht, wie Moralismus, narzisstische Selbstentblößung und Verrohung unsere Umgangsformen beeinflussen und plädiert für eine Rückbesinnung auf Tugenden wie Taktgefühl, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken. Er sieht Takt als eine Möglichkeit, mentalen Schutz zu gewährleisten und gleichzeitig die hochaggressive Natur des Menschen zu kultivieren.
Das Buch erörtert die Notwendigkeit von Abstand und Ritualen, um Verletzungen vorzubeugen und ein konstruktives Miteinander zu fördern. Scherer argumentiert, dass Takt uns hilft, die Härten im menschlichen Umgang zu umschiffen und dem anderen die Initiative zu lassen, sich zu äußern, während wir gleichzeitig seine Grenzen respektieren.
Distanz als Grundlage für echte Nähe
Besonders bemerkenswert ist Scherers Unterscheidung zwischen Taktgefühl und Mitgefühl: „Takt gibt Raum – und ist insofern das Gegenteil von Mitgefühl, als es sich allenfalls eine Ahnung vom Seelenzustand des anderen zutraut und diesem Abstand wahrend begegnet.“ Gerade diese Distanz ermögliche es, den anderen in seiner Andersheit wahrzunehmen und auszuhalten.
Der Autor greift dabei auf verschiedene Quellen zurück, von Rainer Maria Rilkes Gedanken bis hin zu Helmuth Plessners Definition aus dem Jahr 1924: „Die erzwungene Ferne von Mensch zu Mensch wird zur Distanz geadelt, die beleidigende Indifferenz, Kälte und Rohheit des Aneinander-Vorbeilebens durch die Formen der Höflichkeit, Ehrerbietung und Aufmerksamkeit unwirksam gemacht und einer zu großen Nähe durch Reserviertheit entgegenwirkt.“
Kritische Betrachtung
Freilich könnte man nun bemängeln, dass die begrifflichen Abgrenzungen zwischen Höflichkeit, Moral und Perfektion in Martin Scherers Essay nicht immer eindeutig herausgearbeitet sind. Diese Kritik verweist auf eine philosophische Herausforderung, die sich aus der Vielschichtigkeit der behandelten Konzepte ergibt. Höflichkeit, so scheint es, wird oft als oberflächliche Tugend wahrgenommen, während Moral und Perfektion tiefere ethische und idealistische Dimensionen ansprechen.
Scherer gelingt es jedoch, die Grenzen zwischen diesen Begriffen zu verwischen und zugleich eine neue Perspektive auf ihre Bedeutung zu eröffnen: Höflichkeit als distanzierte Nächstenliebe, Moral als konstruktives Aushalten von Differenzen und Perfektion als unerreichbares Ideal einer harmonischen Gesellschaft.
Trotz dieser Unschärfen wird das Buch von vielen als ein inspirierendes Plädoyer für das Würdigen des Andersseins gewürdigt. In einer Zeit, die von Polarisierung und einer zunehmenden Verrohung der Umgangsformen geprägt ist, erhebt Scherer das Taktgefühl zu einer Tugend von fast vergessener Bedeutung. Es ist ein Appell an die Fähigkeit des Menschen, Nähe und Distanz in einem feinen Gleichgewicht zu halten – eine Kunst, die in der heutigen Debattenkultur oft verloren geht.