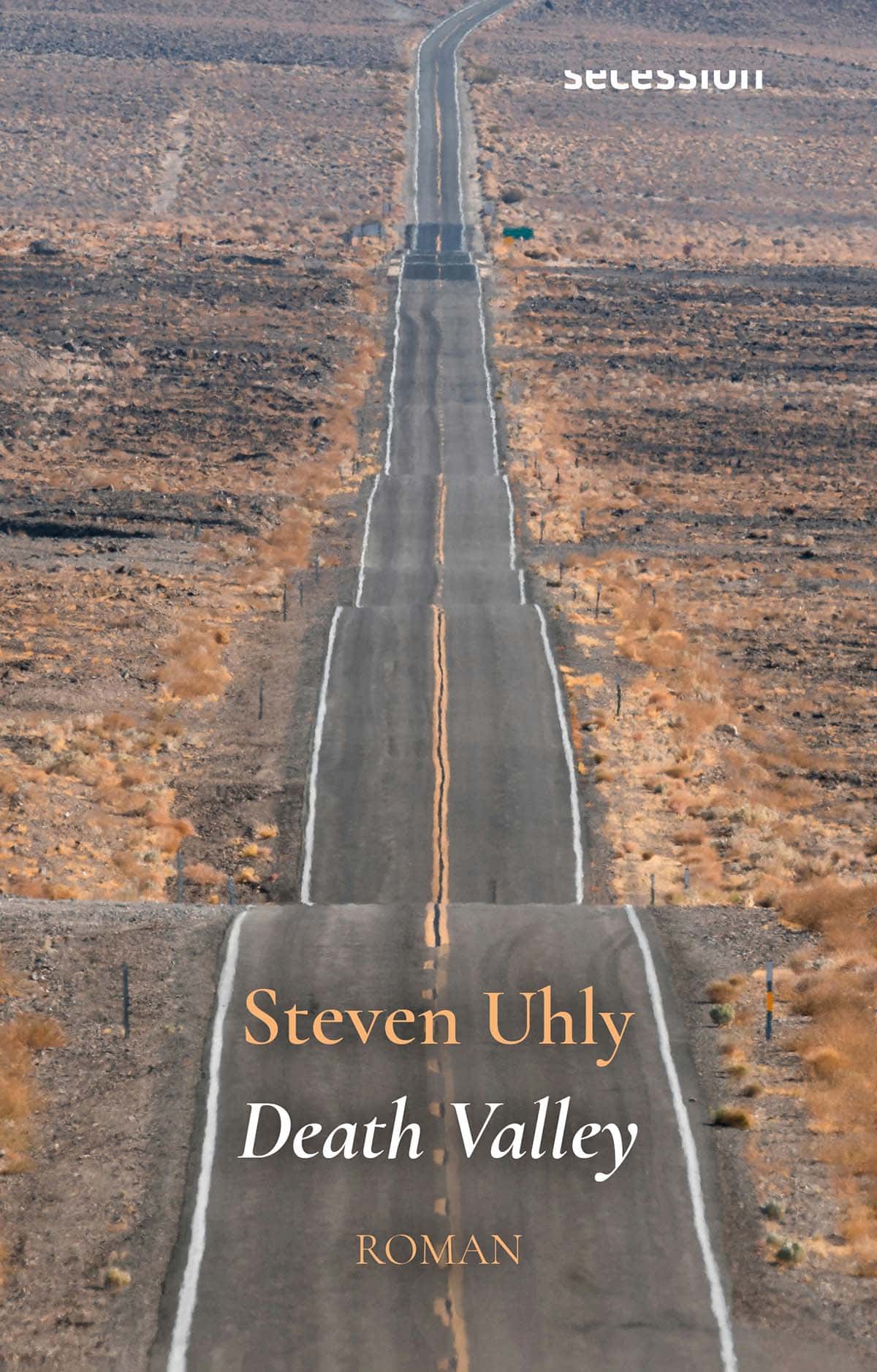Steven Uhlys neuer Roman als bizarrer Gesellschaftsparcours
Steven Uhly wagt mit seinem neuen Roman „Death Valley“ einen Grenzgang: Zwischen dem gleißenden Licht Nevadas und der Schattenseite der amerikanischen Gesellschaft entfaltet sich ein Roadtrip, der weit mehr ist als die Suche nach Trauerbewältigung. Uhly, dessen literarisches Werk stets durch eine eindringliche Beobachtungsgabe und einen Hang zur gesellschaftlichen Reibung besticht, nimmt diesmal die Vereinigten Staaten ins Visier – genauer: das Amerika der Trump-Ära, in dem die Oberfläche der Konsumkultur und die darunterliegenden Brüche ungeschönt zutage treten.
Ein Roman als Roadmovie – Plot und Struktur
Der Roman beginnt mit einem Schock: Die Mutter des Ich-Erzählers, Steven, kommt bei einem Reitunfall im Ubehebe-Krater im Death Valley ums Leben, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten. Was wie der Auftakt zu einer klassischen Trauerarbeit klingt, entpuppt sich rasch als Ausgangspunkt für eine Art Wettrennen zwischen den ungleichen Brüdern Steven und Hans. Beide sind zum Trauern kaum fähig, und so wird der Roadtrip durch das Death Valley zum Vehikel, um sich der eigenen Biografie und den Widersprüchen der amerikanischen Gesellschaft zu stellen.
Steve Uhly schreibt sich selbst als Figur in die Geschichte ein und spiegelt in seinem Protagonisten die Fremdheitserfahrung eines Europäers in den USA. Schon am Flughafen von Washington, später beim Frühstück in Las Vegas, prallen die Selbstverständlichkeiten des amerikanischen Alltags – Fastfood, Plastik, Football und Countrymusik – auf den skeptischen Blick des Deutschen. In pointierten, oft sarkastischen Beobachtungen wird die Konsumkultur demontiert: „Ich bin ein Fressopportunist, passe mich fließend an, Gourmet in Paris, Müllschlucker in Las Vegas.“
Gesellschaftsparcours durch das Amerika der Trump-Ära
Der Roman ist ein Parcours durch die amerikanische Gesellschaft, der die politischen und sozialen Verwerfungen unter der Präsidentschaft Donald Trumps unübersehbar macht. Die „spiegelglatte Oberflächenästhetik“ der Konsumkultur wird zur Metapher für eine Gesellschaft, die sich selbst genügt, aber zunehmend den Kontakt zu ihren eigenen Bruchstellen verliert. Der Roman verweigert sich dabei einfachen Antworten: Statt einer eindeutigen Anklage gegen „die Amerikaner“ oder „Trump“ zeigt Uhly, wie sehr sich die politischen Verschiebungen im Alltäglichen niederschlagen – im Umgang mit Fremden, im Familienleben, im Nebeneinander von Armut und Überfluss.
Die amerikanische Gesellschaft erscheint als Raum der Widersprüche: Auf der einen Seite das Versprechen unbegrenzter Möglichkeiten, auf der anderen Seite die Erfahrung von Entfremdung, Unsicherheit und gesellschaftlicher Kälte. Uhly macht diese Ambivalenz nicht nur an politischen Themen fest, sondern vor allem an den Begegnungen und Beobachtungen seines Protagonisten – etwa wenn dieser feststellt, dass es „keinen doppelten Boden in Amerika“ gebe: „Alles ist genau so, wie es aussieht. You get what you see.“
Die Hauptfigur: Bewegung und Selbstbefragung
Der Protagonist, ein Ich-Erzähler, dessen Name mit dem des Autors identisch ist, gerät immer wieder in neue Umstände, die ihn zwingen, die eigene Biografie und die Beziehung zu seiner Ehefrau zu hinterfragen. Der Roadtrip wird zur inneren wie äußeren Reise, auf der sich die Perspektiven verschieben. Die Begegnung mit der amerikanischen Realität – von der überwältigenden Natur des Death Valley bis zum Alltag in Fastfood-Restaurants – zwingt den Erzähler, sich neu zu positionieren: gegenüber der eigenen Herkunft, der Familie, der Ehe.
Die Ehe, zunächst nur als biografischer Hintergrund präsent, rückt im Verlauf des Romans immer stärker in den Fokus. Die Auseinandersetzung mit dem Tod der Mutter und der Konkurrenz zum Bruder wird zum Katalysator für eine Selbstbefragung, in der die Beziehung zur Ehefrau auf den Prüfstand gerät. Der Roadtrip wird so auch zum Testfall für die Tragfähigkeit von Beziehungen in einer Welt, die von Unsicherheit und Wandel geprägt ist.
Die Erzählweise erinnert an ein Verwirrspiel, das die Komfortzonen der Leserinnen und Leser bewusst herausfordert. Die Sprache ist pointiert, oft von lakonischem Humor durchzogen, und verbindet persönliche Erfahrung mit gesellschaftlicher Analyse. Es ist ein Roman, der den Puls der Zeit aufnimmt, ohne sich der Versuchung einfacher Antworten hinzugeben, und der zeigt, wie sehr gesellschaftliche und persönliche Krisen ineinandergreifen. Uhly gelingt ein literarischer Parcours, der die Oberfläche der amerikanischen Konsumkultur ebenso durchdringt wie die existenziellen Fragen nach Herkunft, Identität und Bindung.