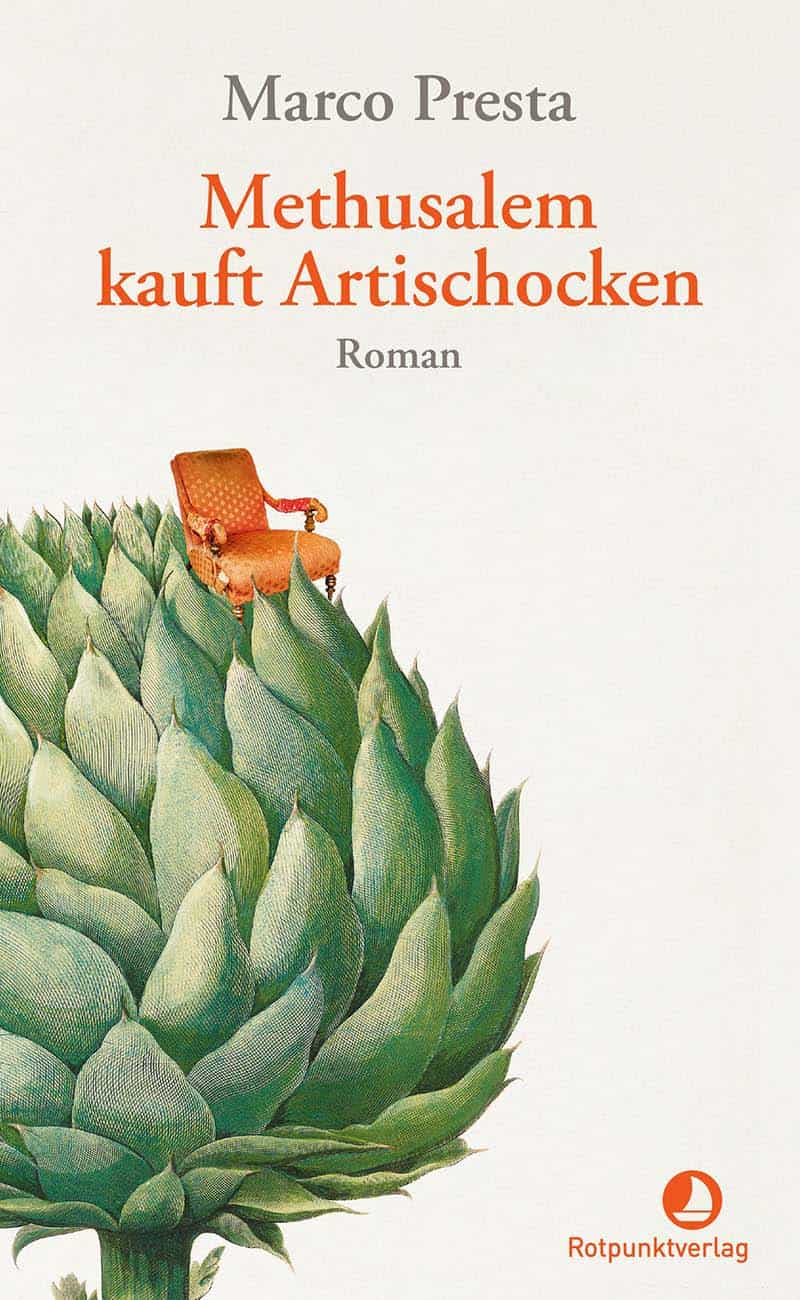Der älteste Mensch der Welt und die jüngsten Gedanken über das Leben
Es gibt Romane, die sich ihrer Zeitlichkeit entziehen, indem sie über das Altern schreiben – und dabei erstaunlich jung wirken. Marco Presta, in Italien als Radiomoderator und Autor bekannt, wagt in „Methusalem kauft Artischocken“ ein literarisches Experiment zwischen Satire, Parabel und Altersweisheit: Er lässt einen 133-jährigen Römer erzählen.
Enrico, pensionierter Grundschullehrer, ist offiziell der älteste Mensch der Welt. Er lebt noch, während Generationen seiner Freunde, Schüler und Geliebten längst vergangen sind. Doch statt gefeiert zu werden, wird er gehasst. Weltweit demonstrieren Menschen gegen seine Existenz – ein groteskes Sinnbild für eine Gesellschaft, die das Alter zwar bekämpft, aber das Leben selbst kaum mehr erträgt.
Marco Presta erzählt über einen Erzähler
Presta verknüpft diese fantastische Prämisse mit einer überraschend stillen, melancholisch-humorvollen Innenschau. Der Methusalem aus Rom ist kein Wundermensch, sondern ein Erzähler, der die Tragikomödie der menschlichen Geschichte in sich trägt. Zwischen Teekochen, Polizeischutz und philosophischen Abschweifungen denkt Enrico über seine Kindheit im frühen 20. Jahrhundert, über Krieg, Liebe und Verlust nach. Dabei schwingt eine leise Ironie mit, die an Italo Svevo oder Primo Levi erinnert – ein Humor, der das Absurde und das Zärtliche in einem Atemzug betrachtet.
„Meine Schuld ist es, am Leben zu sein“, sagt Enrico an einer Stelle. In diesem Satz bündelt sich die moralische Tiefenschärfe des Romans. Presta fragt, was es bedeutet, weiterzuleben in einer Welt, die den Sinn verloren hat. Das hohe Alter wird zum Spiegel einer kollektiven Erschöpfung: einer Menschheit, die den Tod verdrängt, aber das Leben verlernt hat.
Wechselnde Stile und Erinnerungen
Formal bewegt sich Presta zwischen Erzählung und Essay, Anekdote und Aphorismus. Der Text ist durchzogen von Erinnerungen, Dialogen mit seiner Ärztin – die er augenzwinkernd „meine Paläontologin“ nennt – und Begegnungen mit seiner Haushälterin Eunice, die ihn mit pragmatischer Fürsorge auf dem Boden der Realität hält. In diesen Szenen, lakonisch und liebevoll zugleich, blitzt eine tiefe Humanität auf.
Die Übersetzung von Karin Diemerling fängt den rhythmischen, leicht mürrischen Ton Prestas hervorragend ein: das Romanesco mit seinem trockenen Witz, den melancholischen Nachhall der Lebensbilanz, die Wärme eines Mannes, der sich mit seiner Sterblichkeit längst ausgesöhnt hat.
„Methusalem kauft Artischocken“ ist kein Zukunftsroman, sondern ein Gegenwartsroman im Gewand einer Zukunftsvision. Denn der Hass, der Enrico entgegenschlägt, ist nichts anderes als die Überforderung einer Welt, die Alter, Schwäche und Endlichkeit nicht mehr erträgt. Presta schreibt damit, hinter seinem komödiantischen Ton, eine stille Anklage gegen eine Zeit, die die Jugend vergöttert und das Leben funktionalisiert.